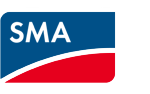Energiewende auf dem Land: Entwicklungschance für Kommunen
Viele kleine Gemeinden in ländlichen Regionen verfügen über ein großes Energiewendepotenzial. Der Anteil erneuerbarer Energien kann weiter steigen, wenn die vorhandene Infrastruktur weiter ausgebaut und modernisiert wird. Ebenso können Abwärme und Abwasser einen größeren Beitrag zur Energieversorgung in Kommunen leisten.